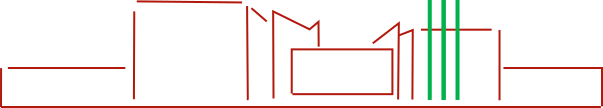Geschichte
Unter dem Begriff Geschichte wird alles das bezeichnet, was sich ereignet hat. Ein
Synonym für Geschichte ist die Vergangenheit. Diese wird vom Historiker wissenschaftlich untersucht
und nachvollziehbar, objektiv und überzeugend dargestellt, indem Ursachen und Wirkungen hinterfragt
und dargestellt werden.
Dabei ist die Geschichte weder räumlich noch zeitlich begrenzt. In einer
Chronologie kann man den Beginn der Weltgeschichte in der europäischen Antike ansetzen oder mit den
Kulturen Ägyptens und des Alten Orients. Was aber ist denn nun eigentlich Geschichte? Menschen gehen
immer wie selbstverständlich von ihrer Existenz in der Gegenwart aus und dass alles einen Sinn
ergibt. Erst in gesellschaftlichen oder individuellen Krisen wird nach dem Zusammenhang eigener
Erfahrungen in der Zeit gefragt.
Das Unterrichtsfach Geschichte soll Orientierung geben in einer
immer komplexer werdenden Welt, indem Zusammenhänge menschlichen Zusammenlebens von der Steinzeit
bis zur Deutschen Wiedervereinigung u.a. mithilfe von Quellen analysiert und erläutert werden.
Exkursionen zu geschichtsträchtigen Orten (Museen, Klöster, Ausstellungen, Konzentrationslager)
machen dabei Geschichte erlebbar und ermöglichen Eindrücke außerhalb des Klassenzimmers, die zuvor
erworbenes Wissen anschaulich festigen. Insgesamt ist das Ziel des Geschichtsunterrichts, die
Schüler zu mündigen Menschen zu erziehen, die den nötigen kritischen Blick auf die Welt haben
Auf den Spuren des unbekannten jüdischen Großvaters
Im Rahmen der Jugendliteraturtage berichtete Sigrid Kleinsorge den Klassen 9a und b sowie der ev. Religionsklasse der 10. Klassen mit Frau Sackmann und Frau Pfeiffer von den Erlebnissen ihrer Familie im 2. Weltkrieg und in der DDR. Dabei las sie aus ihrem Buch „Immerblau“, welches von ihrer Suche nach ihrem Großvater handelt. Das Ziel, welches Frau Kleinsorge mit Ihrem Buch erreichen will, ist eine bessere Kommunikation in Familien, auch über unangenehme Themen wie in ihrem Fall das Verhalten ihres Vaters gegenüber dem Großvater. In jeder der beiden Lesungen stellten zwei Schülerinnen Frau Kleinsorge kurz vor: Sie ist 1940 in Halle geboren, 1960 in die BRD geflüchtet und lebt heute teils in Karlsruhe und teils auf Lanzarote. Sie ist Psychologin, Soziologin und Schriftstellerin.
Sie erzählte von der Tatsache, dass das Reden über ihren Großvater in ihrer Familie ein Tabu-Thema war. Erst ganz spät, nach dem Tod ihres Vaters, fand sie die Identität ihres Großvaters heraus. Er war Jude und lebte als Fotograf in Thüringen. Er wurde während der Reichspogromnacht verhaftet und zusammen mit vielen anderen in das KZ Buchenwald gebracht. Es ist für die Entstehung des Buchenwaldliedes bekannt, welches Frau Sackmann und Frau Pfeiffer uns auch während der Lesungen jeweils vorspielten. Der Großvater schaffte es durch eine gefälschte Schiffsbuchung aus dem KZ zu entkommen. Als er nach Wien floh, wurde er von seiner Jugendliebe versteckt. Einige Monate nach seiner Ankunft wurde er allerdings – als er für einen kurzen Moment unvorsichtig war und es nicht mehr im Versteck ausgehalten hatte – erneut verhaftet und nie wieder gesehen. Es wird vermutet, dass er mit vielen anderen an der Grenze ermordet wurde.
Das alles erfuhr Frau Kleinsorge erst nach dem Tod ihres Vaters, welcher zu Kriegszeiten ein überzeugter Nazi war. Er war ein Chauffeur für die SS. Vermutlich fuhr er sogar Himmler selbst und andere wichtige Persönlichkeiten. Er hinterließ neben seinen Unterlagen Papiere über einen Wohnort ihres Großvaters. Nachdem sie so zum ersten Mal etwas über ihren Großvater erfahren hatte, machte sich Frau Kleinsorge auf den Weg, seine Spuren zu finden, um seinen Leidensweg nachvollziehen zu können. Ihre erste Station war sein ehemaliger Wohnort, Wien. Hier erfuhr sie nur, dass er ursprünglich in einem Dorf in Thüringen gelebt hatte. Als sie hier ankam, waren alle erst einmal sehr verschlossen, als sie nach dem Namen ihres Großvaters fragte, bis schließlich eine ältere Dame sich freute sie zu sehen. Sie hatte dem Anschein nach darauf gewartet, dass jemand kommt und erzählte ihr gerne alles. Auch gab sie Frau Kleinsorge eine Metallbox, welche ein Tagebuch aus seiner KZ-Zeit und einen Judennachweis über seine Beschneidung enthielt. Nach dieser schwer zu verarbeitenden Info reiste sie weiter, um Nachforschungen anzustellen und schrieb ihr Buch über das Thema.
Nach dieser fesselnden Geschichte berichtete die Zeitzeugin uns weiter über ihre Zeit und Flucht aus der DDR. Sie studierte gerade Psychologie, als ihre Mutter und ihr Stiefvater während einer vorgetäuschten Urlaubsreise flohen. Als Verwandte erregte sie Verdacht bei der Stasi. Sie wurde deshalb mehrmals verhört. Nach der erfolgreichen Flucht ihrer Eltern half ihr leiblicher Vater ihr bei der Planung ihrer eigenen Flucht. Sie fuhr mit dem Zug nach Berlin und tarnte ihre Dokumente in einem Gitarrenkoffer, mit welchem sie dann über die Grenze lief. Auch diese Flucht glückte. Ein Jahr später wurde die Mauer gebaut und eine Flucht wäre nicht mehr möglich gewesen.Nach dieser fesselnden Geschichte berichtete die Zeitzeugin uns weiter über ihre Zeit und Flucht aus der DDR. Sie studierte gerade Psychologie, als ihre Mutter und ihr Stiefvater während einer vorgetäuschten Urlaubsreise flohen. Als Verwandte erregte sie Verdacht bei der Stasi. Sie wurde deshalb mehrmals verhört. Nach der erfolgreichen Flucht ihrer Eltern half ihr leiblicher Vater ihr bei der Planung ihrer eigenen Flucht. Sie fuhr mit dem Zug nach Berlin und tarnte ihre Dokumente in einem Gitarrenkoffer, mit welchem sie dann über die Grenze lief. Auch diese Flucht glückte. Ein Jahr später wurde die Mauer gebaut und eine Flucht wäre nicht mehr möglich gewesen.
Wir alle fanden ihre Erzählungen sehr interessant und freuten uns über die ehrlichen Antworten auf unsere Fragen. Insgesamt war es eine tolle, lehrreiche und spannende Doppelstunde.
Tim und Kimon, 10c
Stimmen aus dem Nachgespräch in Klasse 9a
Was fandet ihr an der Lesung am interessantesten?
- „Ich fand interessant, dass sich Vater und Sohn so sehr hassen und dass der Sohn Nazi wurde, obwohl er jüdische Verwandtschaft hat. Also hat er gegen seine eigene Familie gehandelt und gekämpft.“ Jana B.
- „Ich fand die Erzählung mit dem gefundenen Buch am interessantesten. Als die Zeitzeugin das Buch im Nachlass ihres Vaters fand, sah sie, dass es ein Buch mit dem Stammbaum der Familie war. Sie fand das Geburtsdatum ihres Großvaters, aber kein Todesdatum. Sie dachte, dass es unmöglich sei, so alt zu sein, wie der Großvater zu diesem Zeitpunkt hätte sein müssen, also begab sie sich auf die Suche und fragte viele Leute aus der Gegend, in der der Großvater gelebt hatte.“ Tim U.
- „Ich fand am interessantesten, dass ihr Vater, trotz dass er Jude war, Fahrer der Nazis wurde und er keinen Ariernachweis vorzeigen musste.“ Devin R.
- „.... wie der Vater sich gegenüber dem Großvater verhält und nie zu seinem eigenen Vater hält.“ Sophie K.
- „... dass man das Lied in Buchenwald singen musste. Ich wäre niemals davon ausgegangen, dass es so etwas geben würde.“ Moritz M.
- „... dass Frau Kleinsorge keinerlei Wissen von dem Geschehen in ihrer Familie hatte und alles selber herausfinden musste. Das ist sicher ein Schock herauszufinden, dass der Opa ein Jude und der Vater ein Nazi war. Es war bestimmt auch spannend, der Familiengeschichte so nachzureisen und alles Stück um Stück herauszufinden. Dass sie, bis sie 60 Jahre alt war, nichts von ihrer Familie wirklich wusste, fand ich auch sehr überraschend.“ Leonie G.
- „... wie der Vater vom Chef aufgenommen wurde und fast wie sein eigener Sohn gesehen wurde, obwohl der Chef ein Nazi und der Vater Jude war.“ Sophie B.
- „... dass der Großvater sich bei seiner „echten“ Liebe versteckt hat, bis er es nicht mehr ausgehalten hat, rausgerannt ist und verhaftet wurde.“ Elias H.
- „Mich hat am meisten die extreme Angst, die sie beim Haus ihrer Großmutter beschrieben hat, beeindruckt. Da sie diese nach all den Jahren immer noch ausgeprägt gefühlt hat.“ Samson S.
- „... dass es zur Zeit des Nationalsozialismus' geschafft wurde, Juden zu „vertuschen“ und wie es gemacht wurde.“ Valeria P.
- „... wie sie ihrem Instinkt gefolgt ist, das Geheimnis von ihrem Großvater herauszufinden. Die ganzen Reisen, die sie aus Neugier getätigt hat, sind sehr inspirierend.“ Lin A.
- „... dass der Vater Nazi war, obwohl der Großvater Jude war und somit jüdisches Blut in ihm floss.“ Alex S.
- „... dass der Mann, der ihren Vater aufgenommen hat, vorher schon so weit mitgedacht hat.“ Tobias H.
Sollte so eine Art Lesung mit Zeitzeugeninterview wieder durchgeführt werden?
- „Ja, weil ich es interessant fand, was die Menschen erlebt haben, was sie herausfanden und welche Probleme und Geheimnisse es in den Familien gab.“ Jana B.
- „Ich finde so eine Art Lesung mit einer Zeitzeugin gut, da man die Geschichte aus eigener Erfahrung erzählt bekommt und man sich die ganze Krisensituation nochmal besser vorstellen konnte.“
- „Ja, weil es interessant ist die Emotionen und Gefühle von einer, die es miterlebt hat, zu erleben und es verdeutlicht, wie schlimm die NS-Zeit war.“ Sophie K.
- „Ja, solche Lesungen sind immer sehr gut, um ein Thema in der Schule abzuschließen. Wenn man die Geschichten von früher aus persönlicher Perspektive, in Realität hört, ist es immer besser als ein Buch. Somit kann man persönliche Eindrücke mitnehmen und kann sich das alles besser vorstellen und glauben.“ Moritz M.
- „Ja, weil es mir die Situation und Ernsthaftigkeit des Zweiten Weltkrieges noch einmal deutlicher bewusst macht und es deutlich spannender ist, die Geschichte von jemandem zu hören, die einen Bezug dazu hat.“ Leonie G.
- „Ja, weil ich es viel interessanter finde, wenn jemand es persönlich erzählt, statt es aus dem Internet oder Büchern zu lesen. Man erfährt auch viel mehr über Geschichte.“ Sophie B.
- „Ja, weil man davon sehr viel lernt wie es früher war und nicht immer nur davon liest, sondern auch eine Person, die das erlebt hat, zu Gesicht bekommt.“ Elias H.
- „Ja, weil es nochmal etwas anderes ist, wenn eine Person, die diese schreckliche Zeit mitbekommen bzw. die eigene Erfahrungen gemacht hat, einem ihre Geschichte vorliest.“ Valeria P.
Exkursion nach Natzweiler-Struthof: Die Schwere der Geschichte begreifen



Um einen Einblick in die nationalsozialistische Gewaltherrschaft zu erhalten, fuhren unsere Klassen 10c mit Klassenlehrer Michael Dolch und die Klasse 9c mit Geschichtslehrerin Monika Pfeiffer zum Konzentrationslager Natzweiler-Struthof in die Vogesen.
Nach 2,5 Stunden mussten wir kurz vor dem geplanten Ziel anhalten, da der Bus eine Panne hatte. Beide Klassen stiegen aus und wir liefen zu unserer ersten Station außerhalb des Lagers, dem "Chambre à gaz du Struthof", der Gaskammer von Struthof. Anders als man vermuten könnte, diente die Gaskammer nicht der Massenvernichtung, sondern wurde einige Male für pseudowissenschaftliche Experimente genutzt, die 1943/44 stattfanden.
Parallel zur Gaskammer steht das "Restaurant Le Struthof", das während unseres Besuchs von Bauarbeitern renoviert wurde. Das 1906 erbaute Gebäude diente als Hotel und Restaurant und wurde nach der Besetzung des Geländes durch die SS im Jahr 1940 zur SS-Kantine. Nachdem wir unsere Informationen über die Gaskammer und das Restaurant erhalten hatten, setzten wir unseren Spaziergang zu unserem nächsten Ziel fort. Gegenüber dem Lagereingang auf der rechten Seite der Straße fanden wir die Kommandantenvilla, den ersten Ort innerhalb des ausgewiesenen Lagers. Die Villa war eine Sommerresidenz für die Konzentrationslagerkommandanten, die von der SS vor dem Krieg von einem Straßburger Bankier beschlagnahmt worden war – in Hör- und Sichtweite zu den Gräueln innerhalb des KZ wurden hier rauschende Feste gefeiert.
Wir gingen an der Kommandantenvilla vorbei durch das Lagertor und hielten vor der zweiten Baracke. Diese Baracke war die Lagerküche. Die Lagerküche versorgte die einzelnen Blöcke (Baracken). Obwohl die Häftlinge drei “Mahlzeiten” pro Tag bekamen, waren sie extrem unterernährt und verloren in den ersten zwei Monaten ihres Aufenthalts durchschnittlich 25 kg.
Nur wenige Schritte entfernt lag für viele Häftlinge die Aussicht auf Freiheit. Diese Aussicht wurde durch mehrere Reihen von Stacheldraht und von acht mit Maschinengewehren bewaffneten Wachsoldaten auf Türmen versperrt; Wachposten und Hunde patrouillierten Tag und Nacht in der Umgebung. In dieser Zeit wurden zwar einige Fluchtversuche unternommen, aber nur einer war jemals erfolgreich.
Wir setzten unseren Rundgang zum Galgen auf einer der höher gelegenen Terrassen des Lagers fort. Der Galgen ist ein etwa vier Meter hohes Gerüst mit einer kastenförmigen Plattform darunter, an der ein Pedal befestigt ist. Tritt man auf das Pedal, klappt der Deckel des Kastens herunter und bricht dem Gefesselten das Genick. Der Galgen ist heute von einem kleinen Zaun umgeben und steht als bedrückendes Bauwerk, das den Schrecken derer, die dort ihr Leben verloren, vermittelt. Wir legten eine Schweigeminute ein und gingen dann das Lager hinunter zum Appellplatz gegenüber der Gedenkstätte. Hier versammelten sich die 5000 Häftlinge am Morgen, bevor sie zu den ihnen zugewiesenen Aufgaben abgefertigt wurden. Bei der nahegelegenen Treppe wurden wir gebeten, eine Vermutung darüber anzustellen, warum die Stufen unterschiedlich hoch angebracht waren. Diese wurde nämlich bewusst so gebaut, damit die Gefangenen in ihrem unterernährten Zustand ihre Hände benutzen mussten, um jedes Knie über die Stufen zu heben, damit sie die Treppe hinaufsteigen konnten.
Wir setzten unseren Rundgang bergab zum so genannten "Bunker" oder, wie es offiziell hieß, zum "Zellenbau" fort. Wir erkundeten die Zellenräume, die klaustrophobischen Kammern und den "Peitschenblock". Unsere Klasse versammelte sich dann in einer der Zellen, um sich ein Bild von den unerträglichen Bedingungen in einer Zelle zu machen. Zeitweise waren hier bis zu 25 Häftlinge zusammengepfercht, die nicht richtig sitzen, schlafen oder sich ausruhen konnten und nur sehr wenig Brot und Wasser als Verpflegung erhielten.
Neben dem "Bunker" befindet sich das Krematorium. Ein Haus des Grauens, das mit Grausamkeit und diabolischen Absichten gebaut wurde. Das Krematorium wurde für Hinrichtungen und die Verbrennung der Toten genutzt. Die aus den Leichen gewonnene Energie wurde zur Beheizung der Wassertanks für die Bade- und Duschabteilung verwendet. Die Asche der Eingeäscherten wurde verpackt und für 60 bis 100 Reichsmark an die Familien der Häftlinge verkauft, zusammen mit einem Brief, in dem eine erfundene Todesursache vermerkt war, meist eine Lungenentzündung oder eine andere erfundene Krankheit. Jeder in der Klasse erhielt eine Skizze mit dem Bauplan des Krematoriums, und wir hatten ein paar Minuten Zeit, die Räume zu erkunden.
Nachdem wir dieses fürchterliche Gebäude besichtigt hatten, gingen wir zur Klärgrube, die sich zwischen dem Krematorium und dem "Bunker" befindet. In der Klärgrube wurden die übrige Asche und die Überreste des Krematoriums aufbewahrt, und man schätzt, dass dort die Überreste von etwa 3000 bis 4000 Menschen liegen. Menschen, die an Erschöpfung, Hunger, Kälte, Krankheiten, Schlägen und Hinrichtungen starben. Heute stehen dort ein großes Blumenkreuz und eine Gedenkwand, die an die Opfer des Lagers erinnern. Anschließend hatten wir Zeit, die Museumsbaracken und das Dokumentationszentrum zu besichtigen und uns auszuruhen, bevor wir den Bus zurück zur Schule nahmen.
Während der Rückfahrt wurde das Lied "Die Moorsoldaten" über die Buslautsprecher gespielt. Dieses Lied wurde von Häftlingen des Konzentrationslagers Börgermoor geschrieben und von verlegten Häftlingen in anderen Lagern verbreitet. Das Lied hat eine langsame Melodie, die den Marsch eines Soldaten widerspiegelt, und ist absichtlich repetitiv und erzählt von der täglichen harten Arbeit unter harten Bedingungen.
Am Ende der Reise waren unsere Klassen um einiges besser informiert und hatten ein viel besseres Verständnis über die Zustände in diesem Lager gewonnen. Außerdem machte uns der gute Zustand dieses Lagers erst so richtig klar, dass dieses schreckliche Ereignis noch gar nicht so weit zurückliegt. Diese aufschlussreiche Erfahrung konnte nicht durch bloßes Lesen oder Hören über solche Ereignisse gewonnen werden. Um die Schwere der Geschichte zu begreifen, muss man sich die Mühe machen, ihre Folgen aus erster Hand zu erleben.
Abdelrahman Elkaseer, Alexander Gamer, Elias Walther 10c
Führung durch das Kelten-Museum: Auf den Spuren von Asterix und Obelix
Heute war ein schöner Tag! Wir, die Klasse 6d mit Frau Nagel und Frau Pfeiffer, trafen uns in der Schule. Los ging‘s um 8:45 Uhr. Wir fuhren mit Bus, Bahn und U-Bahn zum Keltenmuseum nach Hochdorf bei Vaihingen. Für manche war es das erste Mal, dass sie unter die Erdoberfläche in Karlsruhe fuhren und sie staunten. Es war eine lustige Fahrt: Wir haben viel gelacht, gespielt und gevespert. Am Anfang des Tages war es noch etwas kühl, aber dann kam die Sonne und es wurde heiß.
Das Museum
Nachdem wir vor dem Museum eine kleine Essenspause gemacht hatten, begann für uns die Führung. Bald erfuhren wir bereits, warum genau an diesem Ort ein Museum für die Kelten – auch Gallier, Galater oder Bretonen genannt - gebaut worden war: Weil hier in der Nähe ein Fürstengrab gefunden worden war. Zuerst wurde uns eine nachgestellte Ausgrabungsstätte gezeigt. Wir erfuhren, dass es im Umkreis von Hochdorf/Enz noch viel mehr Fürsten- und normale Gräber gibt. Manche werden noch gar nicht ausgegraben, weil man sie den späteren Archäologen und Archäologinnen mit noch besseren Forschungsgeräten überlässt. Mit Hilfe einer großen Karte erfuhren wir, wo überall die Kelten gelebt hatten und dass sie Handel mit den Griechen getrieben haben.
Wir sahen Nachbildungen von Grubenhäusern, die bei der Ausgrabung gefunden worden waren. Viele Nachbildungen von gefundenen Gegenständen sind ausgestellt. Aber auch kleinere Artefakte im Original, wie zum Beispiel Fibeln, die damaligen Sicherheitsnadeln, Pfeilspitzen, Stoffreste und Köcher.
Vier Leute aus unserer Klasse durften sich als Kelten und Keltinnen verkleiden. Sehr bequem war der Stoff allerdings nicht, sondern eher kratzig. Anschließend sahen wir etwas ganz Besonderes in einer Vitrine: das Originalskelett vom toten Fürsten. Es war fast vollständig außer einer Kniescheibe. Diese, wird vermutet, musste er wohl verloren haben, da der Fürst mit einer Kutsche auf der er zum Lenken des Wagens stehen musste, heruntergefallen war und sich verletzt hatte. Nach diesen Infos erfuhren wir, dass die Kelten schon Stoffe herstellten. Sie hatten eine Technik erfunden, mit der sie ganz komplizierte und sehr modern wirkende Muster herstellen konnten. Sie fertigten sogar schon Bänder an, die auf den beiden Seiten unterschiedliche Muster hatten.
Danach ging es einen Gang nach unten zum Highlight des Museums: der originalgetreuen Nachbildung der Grabkammer. Alles ist detailgetreu nachgemacht, wie es damals nach der Beerdigung verlassen wurde. Die Grabbeigaben sind in Originalgröße beigelegt. Der Fürst liegt auf einer Art Sofa mit Rollen aus kleinen Figürchen. Die sehen aus wie Frauen, die Einrad fahren. Er ist ausgestattet mit einem Binsenhut, der ihm vom Kopf rutscht, Goldhalsring und -armreif und goldenem Dolch an der Seite. Die Schnabelschuhe wirken sehr modern. Überall an den Wänden glänzt es golden. Ein riesiger Kessel enthält noch Met und ist verziert mit drei goldenen Löwen, zwei griechischen und einem keltischen. Ein Wagen ist vollgeladen mit goldenem Zaumzeug und mit vielen Tellern, damit der Fürst im Jenseits gut speisen kann.
Der Grabhügel
Nach dem Besuch im Museum liefen wir alle zum ca. 450 m entfernten, an der Originalstelle stehenden Fürstengrabhügel. Wie in antiken Zeiten ist er 6m hoch und 60 m breit und bereits von weitem zu erkennen. Bei seiner Entdeckung war der Hügel über der fürstlichen Grabkammer fast ganz abgetragen. Nachdem ungefähr 7000 m³ Erde und Steine aufgeschüttet worden waren, konnte er 1987 wieder eingeweiht werden. Als wir den steilen Weg nach oben erklommen hatten, konnten wir die schöne Aussicht genießen. Auf dem Grabhügel aßen wir alle unsere Vesper. Zum Glück war das Wetter gut: Es war ein bisschen windig, aber da es an diesem Tag warm war, war dies eine gute Abkühlung. Außerdem lag auf dem Hügel gemähtes Gras, mit dem man sich gut abwerfen konnte. Alle tobten herum, kämpften, erkundeten die Umgebung, bestaunten eine Blindschleiche oder redeten. Einige kamen auf die Idee, Papierflieger den Berg hinuntersegeln zu lassen.
Das keltische Gehöft
Nun ging‘s zum nächsten Teil unseres Ausfluges: Wir erkundeten das Außengelände des Museums. Das Gelände, auf dem das Museum steht, war im 6.Jahrhundert vor Chr. eine frühkeltische Siedlung. Als Archäologen in den 80er und 90er Jahren das Dorf ausgruben, fanden sie Spuren von Wohnhäusern, Hochspeichern, Grubenhäusern und Erdkellern. Ein Gehöft dieser Siedlung mit all seinen Einzelgebäuden wurde von experimentellen Archäologen nachgebaut und so konnten wir die Architektur der Kelten betreten. Alle hatten großen Spaß, besichtigten die verschiedenen Häuser mit Dächern aus Stroh und Holzschindeln, kletterten in den Hochspeicher und gingen aus dem Hauptgebäude aus den Fenstern hinaus. Innen sahen wir gemütliche Felle, Trinkgefäße, die wie Hörner aussahen, Scherben und bemalte griechische Trinkschalen, die auf weiten Wegen aus Athen hergekommen waren. Am Rand des Geländes gab es ein Feld, auf dem Pflanzen wie in der keltischen Zeit wuchsen und wir konnten viel über damaligen Ackerbau lernen. Damit endete unser Besuch im Keltenmuseum.
Heimreise
Am späten Nachmittag ging der Ausflug langsam zu Ende und wir fuhren mit dem Bus zum Bahnhof Vaihingen. Nach langem Diskutieren – denn eigentlich hätten wir Essen und Trinken für den ganzen Tag mitnehmen sollen - durften wir beim Bäcker uns noch etwas zu essen besorgen.
Als der Zug endlich eintraf, stiegen wir ein und fuhren zum Karlsruher Hauptbahnhof und von dort zum Bärenweg. Wir waren alle sehr müde und sind mit der Bahn oder dem Fahrrad nach Hause gefahren. Es war ein sehr schöner Tag und es hat Spaß gemacht. (Max, Janek, Maximilian, Lennert, Philipp, Theo, Lorenzo aus Klasse 6d)
Exkursion: Spannende Einblicke ins Klosterleben Maulbronns